Virtuelles Denkmal "Gerechte der Pflege""... die tolldreisten, machthungrigen Horden, sie konnten den Geist nicht morden!"
Rosa, genannt Rosel, wurde am 8.11.1925 in Ober-Roden bei Dieburg geboren. Ihre Eltern waren Salomon Hecht und Berta, geborene Kahn am 13.3.1899. Ihr jüngerer Bruder Jakob, nur Jaky gerufen, kam am 28.2.1927 zur Welt. Zur Familie gehörten noch die Großeltern, der Schuhmacher Jakob Kahn, der bereits verstorben war, die Großmutter Frieda Kahn und ihr Onkel, der Bruder ihrer Mutter, Ludwig Kahn. Rosels Eltern betrieben in Ober-Roden ein Schuhgeschäft. Sie waren die einzige verbliebene ansässige jüdische Familie im Ort, was bis 1933 kein Problem darstellte.
Rosel und Jaky besuchten wie alle anderen Kinder auch den katholischen Kindergarten der „Schwestern von der Göttlichen Vorsehung“, umgangssprachlich als Schwesternhaus oder Schwesternschule bezeichnet, und die Trinkbornschule. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten breitete sich der Antisemitismus rasant aus, auch gegen Familien, die bisher im guten Einvernehmen mit den christlichen Nachbarn gelebt hatten. Dass bekamen auch jüdische Kinder extrem zu spüren.
Zusätzlich zerbrach die Ehe von Rosels Eltern und ihr Vater Salomon verließ die Familie 1935. Er soll versucht haben, in seinen Heimatort Stárkov zurückzukehren. Stárkov hieß früher Starkstadt und gehörte ab 1919 zur neugegründeten Tschechoslowakei. Was zum Scheitern der Ehe führte, wird sich nicht mehr klären lassen, denn die Beteiligten können dazu keine Angaben mehr machen. Eventuell waren die politischen Verhältnisse ausschlaggebend. Hatte sich vielleicht Rosels Vater politisch betätigt, Stellung bezogen zu den Nazis? Denn 1935 gingen die Nazis in der Gegend gegen politische Gegner massiv vor, es kam zu einer Verhaftungswelle. Eigenartigerweise verließ auch Rosels Onkel Ludwig 1935 Ober-Roden und wanderte nach Palästina aus. In Städten emigrierten jüdische Mitbürger eher und früher als im ländlichen Raum. So erstaunt es, dass Ludwig Kahn bereits 1935 das Land verließ. Ob Salomon Hecht jemals in Stárkov ankam ist ungewiss, denn ab seinem Weggang gab es kein Lebenszeichen mehr von ihm. Auch bei seinen Kindern meldete er sich nicht.
Für Rosel und Jaky muss es eine furchtbare Erfahrung gewesen sein. Der Vater und der Onkel weg, mit Mutter und Großmutter alleine in einem Umfeld, das immer bedrohlicher wurde und auch vor Kindern nicht Halt machte.
Ihr Bruder wurde zunächst privat unterrichtet. In Dieburg hatten jüdische Bürger einen Unterricht organisiert. Etwa ein Jahr später folgte er seiner Schwester nach Frankfurt. In der Reichspogromnacht, auch als Reichskristallnacht bezeichnet, drang der Nazimob in Rosels und Jakys Elternhaus ein, plünderte und schlug alles kurz und klein. Anfang 1939 mussten Berta und ihre Mutter das Schuhgeschäft schließen und wurden gezwungen, das Haus weit unterm Preis zu verkaufen. Doch auch Rosel, ihr Bruder und die anderen Kinder in der Waisenanstalt waren dem Naziterror in der Reichspogromnacht ausgesetzt. Nazis überfielen die Einrichtung und zerstörten in Anwesenheit der Kinder die Einrichtung.
Den sehr engagierten Heimeltern Rosa und Isidore Marx war es sehr wichtig, dass ihre Kinder nicht nur die Schule abschlossen, sondern auch eine Ausbildung machen konnten. Zu dieser Zeit war es jedoch für jüdische Jugendliche ausgesprochen schwierig, an eine Ausbildung zu kommen. Die Quellen geben an, sie sei Kinderpflegerin gewesen, an anderer Stelle Schwesternschülerin. Aufgrund ihres Alters gehe ich davon aus, dass sie zunächst die Ausbildung zur Kinderpflegerin absolvierte mit anschließender Ausbildung zur Säuglingspflegerin. Für die Ausbildung zur Krankenschwester war sie zu jung. Das würde erklären, dass sie 1939 im Frankfurter Kinderhaus der weiblichen Fürsorge, Hans-Thoma-Straße 24, gemeldet war. Denn dieses Kinderhaus hatte eine Säuglingsstation.
Mit dem zunehmenden Naziterror war die Waisenanstalt mit eigentlich 75 Plätzen restlos überfüllt. Rosa und Isidore Marx begannen fieberhaft, für ihre Zöglinge Zufluchtsorte zu suchen. Es gelang ihnen, viele ihrer Kinder in Kindertransporte unterzubringen und organisierten selber auch Kindertransporte nach England, Schweiz, Frankreich, Belgien und Niederlande. 1938 erhielten die Heimeltern 35 Einwanderungsgenehmigungen für Palästina und im April 1939 konnte so Rosels Bruder Jaky mit 34 anderen Kindern nach Palästina entkommen. Ende August 1939 begleitete, wie so oft, Isidore Marx einen Kindertransport nach England. Am 1.9.1939 überfielen die Nazis Polen und damit konnte Isidore Marx nicht zurückkehren, was letztendlich seine Rettung bedeutete. Seiner Frau gelang es sogar noch nach Kriegsbeginn im März 1940 einige Mädchen über Italien nach Palästina zu schicken. Um die 1000 Kinder konnte das Ehepaar Marx retten. Rosa Marx selber konnte nicht entkommen und wurde 1942 deportiert und ermordet.
Ab etwa 1941 musste Rosel im Jüdischen Altersheim, Wöhlerstraße 6, leben. Vermutlich wurde sie dorthin eingewiesen und es ist anzunehmen, dass sie dort in der Pflege arbeitete. Zu diesem Zeitpunkt war es bereits ein NS-Sammellager, in denen jüdische Mitbürger zur Vorbereitung der Deportationen zusammengepfercht wurden. Auch ihre Mutter Berta befand sich zu dieser Zeit in einem NS-Sammellager in der Obermainanlage 24.
Am 12.11.1941, vier Tage nach Rosels 16. Geburtstag, wurde sie mit ihrer Mutter und über 1000 Leidensgenossen von Frankfurt nach Minsk deportiert. Sechs Tage dauerte die Fahrt ohne ausreichend Wasser, Nahrungsmittel und fehlenden sanitären Einrichtungen. Im Ghetto von Minsk lagen noch Leichen der jüdischen Menschen aus Weißrussland herum, die man kurz vorher ermordet hatte, um Platz für die Verschleppten aus Deutschland zu machen. Platzmangel, Hunger, Kälte, Wassermangel und mangelnde sanitäre Ausstattung begünstigten Seuchen im Ghetto. Wer nicht an diesen inhumanen Bedingungen starb, kam nach Maly Trostinec und wurde dort in Gaswagen oder im Wald von Blagowschtschina durch Erschießen ermordet.
Nicht einmal 1% der verschleppten jüdischen Menschen aus Frankfurt erlebten die Befreiung des Ghettos am 3.7.1944 durch die Rote Armee. Rosa Hecht, genannt Rosel, und ihre Mutter Berta gehörten nicht zu den Überlebenden.
Quellen: www.stolpersteine-in-roedermark.de; www.tenhumbergreinhard.de: Statistik des Holocaust: Bundesarchiv Gedenkbuch; Yad Vashem; Michael Löw; https://roedermark.de/
Hedwig Heidenheimer
Hedwig Heidenheimer, geboren am 29.12.1897 in Öhringen, war Krankenpflegeschülerin im Jüdischen Krankenhaus Fürth, wo sie auch wohnte. Ihre Eltern hießen Elias Heidenheimer und Karoline Heidenheimer, geborene Neumann. Die Eltern hatten in Öhringen eine Viehhandlung.
Am 10.9.1942 wurde Hedwig unter der Nummer 584 mit dem Transport II/25 Da 512 von Nürnberg nach Theresienstadt deportiert.
Hedwig Heidenheimer starb dort am 15.6.1943.
Quellen: Israelitische Kultusgemeinde Fürth, Memorbuch; YAD VASHEM
Henrietta Heijmans
Henrietta Heijmans wurde am 19.7.1917 in Winterswijk geboren. Die Krankenschwester hatte vielleicht versucht, unterzutauchen, denn der Bürgermeister von Winterswijk beantragte einen Haftbefehl gegen sie, weil sie ohne Genehmigung ihren Wohnsitz veränderte. Es könnte aber auch sein, dass sie einfach umzog, um Arbeit zu bekommen, denn der Bürgermeister von Winterswijk hatte auch erwähnt, dass sie arbeitslos war.
Sie wohnte zumindest vorübergehend in Den Haag, in der Kortenaerkade 9. Im gleichen Haus lebte auch Jeanette Mogendorff, ebenfalls eine jüdische Krankenschwester. Beide Krankenschwestern waren dort ordnungsgemäß angemeldet, was nicht für ein Untertauchen spricht.
Henrietta Heijmans wurde nach Auschwitz verschleppt und am 27.8.1943 dort ermordet.
Quellen: Joods Monument; YAD VASHEM
Lotte Heilberg, geb. Moses
Lotte Heilberg, geborene Moses am 12.11.1913 in Köln war Krankenschwester. Ihr wurde die Staatsangehörigkeit durch die Nazis genommen. Unter der Nummer 461 mit dem Transport XXIV verließ sie am 4.4.1944 das belgische SS-Sammellager Mechelen. Im KZ Auschwitz-Birkenau wurde sie unter der Häftlingsnummer 76646 registriert.
Die Krankenschwester überlebte und kehrte durch die Repatriierung nach Belgien zurück.
Ich danke für die Recherche Frau Laurence Schram vom Jüdischen Deportations- und Widerstandsmuseum (JDWM) in der ehemaligen Mechelner Dossinkaserne.
Klara Huhn wurde am 18.7.1895 in Staitlingsfeld geboren. Sie heiratete Adolf (Adolphe) Heilbronn. Das Ehepaar bekam die Kinder Charlotte Henriette, geboren am 17.8.1923 in Luxenburg, und Ernst (Ernest), geboren am 21.4.1926 in Luxemburg. Am 29.9.1940 immigrierte die Familie nach Belgien. Dort wohnten sie in Berchem Sainte Agathe, Rue Evariste de Meersman 39 und ab dem 3.1.1942 in Uccle, Rue du Framboisier 3.
Die Nazis erklärten die Krankenschwester als staatenlos. Am 10.4.1943 kam sie in das SS-Sammellager Mechelen. Am 19.4.1943 wurde sie unter der Nummer 420 mit dem Transport XX nach in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Das war der Zug, den drei junge Männer, Youra Livchitz, Jean Franklemon und Robert Maistriau, mit ungeheuerem Mut und Dreistigkeit stoppten, um Deportierten die Flucht zu ermöglichen. Sie konnte leider nicht flüchten. Klara Heilbronn gilt als verschollen. Ihr Sohn hatte überlebt und füllte das Erinnerungsblatt bei YAD VASHEM für sie aus.
Quelle: Deportationsliste XX Mechelen - Auschwitz; YAD VASHEM; Memorial des Großherzogtums Luxemburg (6. August 1949)
Berta Flehinger wurde am 27.5.1883 in Flehingen bei Bretten in Baden geboren. Ihre Eltern waren Abraham Flehinger und Janetta, geborene Lieben oder Sieben. Sie war verheiratet mit Siegmund (Süssmann) und hatte ein Kind.
1937 wohnte sie in Köln in der Richard Wagner Straße 18. Die Krankenschwester arbeitete im Israelitischen Asyl, das Jüdische Krankenhaus in Köln.
Aus ihrer Wohnung wurde sie vertrieben und lebte zuletzt in der Jahnstraße 2 im sogenannten „Judenhaus“. Am 22.10.1941 wurde sie in das Ghetto Litzmannstadt (Lodz) verschleppt.
Am 11.5.1942 wurde Berta Heilbrunn in das Vernichtungslager Kulmhof (Chelmno) deportiert und ermordet.
Ein Cousin aus den USA füllte für Berta Heilbrunn das Gedenkblatt bei YAD VASHEM aus.
Quellen: YAD VASHEM; Das Bundesarchiv Gedenkbuch
Bertha (Betty, Berti) Heilbrunn
Berti Heilbrunn wurde am 27.5.1918 in Borken in Hessen geboren. Ihre Mutter war Selma Rosenbusch, die mit Frida Amram (siehe dort) in Borken zur Schule ging. Zuletzt arbeitete die Krankenschwester im Kinderhaus der Weiblichen Fürsorge in Frankfurt am Main. Nachdem die dortige Oberin Frida Amram verhaftet wurde, leitete deren Schwester Goldine Hirschberg das Kinderhaus weiter. Am 15.9.1942 wurden 43 Kinder und Mitarbeiter des Kinderhauses nach Theresienstadt und Auschwitz deportiert.
Zurück blieb Berti Heilbrunn mit 15 Kindern. Vermutlich handelte es sich bei diesen Kindern um solche, die nach der NS-Ideologie nicht als „Volljuden“ galten und deshalb noch nicht deportiert wurden. Am 24.9.1942 wurde sie ab Frankfurt am Main nach Raasiku bei Reval (Tallinn) deportiert.
Im August 1944 wurde Bertha Heilbrunn in das KZ Stutthoff verschleppt und ermordet.
Quellen: YAD VASHEM; Frankfurt.de; Das Bundesarchiv Gedenkbuch; Alemannia Judaica
Eigene Webseite von Beepworld Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular! |
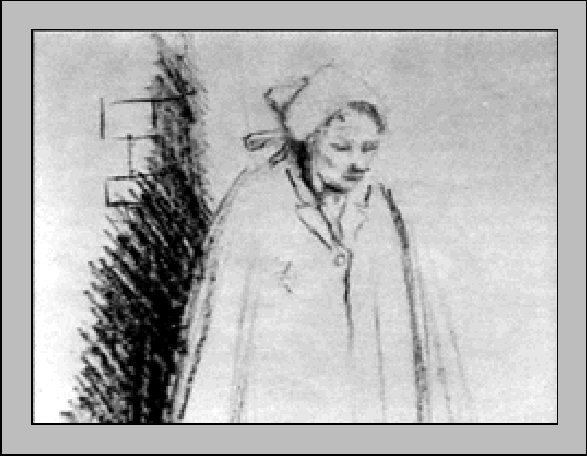
 Rosa (Rosel) Hecht
Rosa (Rosel) Hecht Klara (Claire) Heilbronn-Huhn
Klara (Claire) Heilbronn-Huhn Berta Heilbrunn, geb. Flehinger
Berta Heilbrunn, geb. Flehinger