Virtuelles Denkmal "Gerechte der Pflege""... die tolldreisten, machthungrigen Horden, sie konnten den Geist nicht morden!"Elsie Berg
Elsie besuchte bis 1937 die Königin-Luise-Schule in Köln. 1938 flüchteten Mutter und Tochter in die Niederlande. Am 21.5.1942 begann Elsie die Ausbildung zur Krankenschwester in der psychiatrischen Anstalt „Centraal Israëlitisch Krankzinnigengesticht Het Apeldoornse Bos“.
Vom 21. bis 22.1.1943 wurden circa 1200 Patienten und 51 Pflegekräfte brutal in 40 Lastwagen verfrachtet und in das Durchgangslager Westerbork geschafft. Dort wurden sie in einen Zug getrieben, der morgens um sieben Uhr nach Auschwitz abfuhr.
In Auschwitz wurden die Patienten sofort in Gaskammern ermordet oder erschossen. 50 Pflegekräfte kamen zunächst ins Lager zur Zwangsarbeit. Einer der Pflegekräfte war entweder unterwegs gestorben oder zu krank zum Arbeiten. Von den im Lager registrierten Pflegepersonal überlebte niemand.
Auch Elsies Mutter wurde deportiert. Sie überlebte das KZ, starb aber nach ihrer Befreiung durch die Rote Armee am 30.4.1945 an Typhus in dem brandenburgischen Dorf Tröbitz.
Ihre Tochter, die neunzehnjährige Krankenpflegeschülerin Elsie Berg wurde bereits am 25.1.1943 in Auschwitz ermordet.
Heute erinnert an Elsie in Köln ein Stolperstein, für den die Schülerinnen und Schüler ihrer ehemaligen Schule die Patenschaft übernommen hatten. Er befindet sich vor dem Neubau der Königin-Luise-Schule in der Palmstraße 1.
Quelle: Joods Monument; Yad Vashem; geni.com; Königin-Luise-Schule in Köln https://www.koenigin-luise-schule.de/nationalsozialismus-kls.html; Stadt Köln Stolpersteine
Tzirel Bernhaut, geb. Zelmanowicz Tzirel wurde am 22.6.1902 in Konin in Polen geboren. Ihre Eltern waren Moshe Zelmanowicz, geboren 1879, und Trana, geborene Gutman 1878. Ihre Geschwister waren Dobra, Mark, Szlomo, Chana und Yeti. Ihre Eltern wurden in das Vernichtungslager Majdanek deportiert und ermordet. Von ihren Geschwistern überlebte nur ihr Bruder Mark die Shoa.
Die Krankenschwester war mit dem Chemiker Jozef Berenhout (Yosef Bernhaut), geboren am 7.7.1904 in Lemberg, verheiratet. Sie hatten einen Sohn namens Natan, geboren 1927.
Vermutlich war das Ehepaar mit ihrem Sohn nach Belgien geflüchtet in der Hoffnung, dort in Sicherheit zu sein. Allerdings wurden sie nach der deutschen Besetzung in Belgien verhaftet, als sogenannte Staatenlose erklärt und im belgischen SS-Sammellager Mecheln eingesperrt.
Am 31.10.1942 wurde das Ehepaar mit dem XVII. Transport unter der Nummer 764 und 763 nach Auschwitz verschleppt.
Es muss davon ausgegangen werden, dass Tzirel, Yosef und Natan Bernhaut den Holocaust nicht überlebten, da es seitdem nie mehr ein Lebenszeichen von ihnen gab. Quellen: Ich danke für die Recherche Frau Laurence Schram vom Jüdischen Deportations- und Widerstandsmuseum (JDWM) in der ehemaligen Mechelner Dossinkaserne; Yad Vashem; geni.com
Beate Berger
Nach ihrer Schulzeit arbeitete sie zunächst als Verkäuferin. 1910 kam sie nach Frankfurt und wurde Krankenpflegeschülerin am Jüdischen Krankenhaus. 1912 schloss sie die Ausbildung erfolgreich ab. Im I. Weltkrieg meldete sich Beate freiwillig, arbeitete als Operationsschwester und von 1916 bis 1918 in der deutschen Sanitätsmission in Bulgarien. Ab 1918 war sie Oberschwester in Frankfurt und Pforzheim.
Das ehemalige Krankenhaus der Jüdischen Gemeinde in der Auguststraße in Berlin diente am Ende des I. Weltkrieges als Unterkunft für jüdische Flüchtlingskinder aus Osteuropa. 1922 übernahm Beate die Leitung des Hauses und machte ein Kinderheim daraus, dem sie 1924 den Namen Beith Ahawah („Haus der Liebe“) gab.
Das zionistisch ausgerichtete Kinderheim, das nach reformpädagogischen Konzepten arbeitete, beherbergte zu Beginn der 1930er Jahre bereits 120 Kinder. Viele Kinder kamen aus Osteuropa, waren Waisen oder Sozialwaisen.
Bereits zum Ende der Weimarer Republik beobachteten sie und die Kinder direkt vor dem Heim bedrohliche Naziaufmärsche. Als die Nazis 1933 die Macht übernahmen, erkannte Beate sehr schnell die Gefahr für ihre Kinder und plante die Evakuierung des Heimes nach Palästina.
Um ihre Pläne umzusetzen, benötigte sie Geld. Von der jüdischen Gemeindeleitung war nichts zu erwarten, aber es gelang ihr, die jüdischen Maler Max Lieberman und Herman Struck zu überzeugen, für die Kinder ihre Werke in einer Auktion zu verkaufen. Schließlich schaffte sie es, 30.000 Mark zusammenzubekommen, das Startkapital für ein Kinder- und Jugenddorf in einer kleinen Gemeinde nahe Haifa im Norden von Israel.
Heimlich reiste sie nach Palästina und verhandelte mit den Engländern, um eine Evakuierung des Heimes zu ermöglichen. Schließlich erklärte sich die britische Regierung bereit, 30 Reisezertifikate für Kinder auszustellen unter Bedingungen. Die Kinder mussten 15 bis 17 Jahre alt und ärztlich bescheinigt gesund sein. Außerdem forderten sie einen Nachweis eines zionistischen Vorbereitungslagers und die Zustimmung vorhandener Eltern. Wenn das Kinderheim in Palästina fertiggestellt sei, würde man ihr weitere Reisezertifikate geben.
Bereits am 9.4.1934 reiste sie mit den ersten 35 Kindern nach Palästina. Ihr gelang es bis 1939, etwa 300 Kinder in Kleingruppen nach Palästina zu schleusen. 100 Kinder kamen aus Deutschland, 75 aus Österreich, 15 aus Italien und circa 100 aus Polen, Tschechien und Ungarn.
Etwa 20 Kinder brachte Beate nicht mehr aus Berlin heraus, weil sie unter 14 Jahren waren. Diese Kinder wurden nach Auschwitz deportiert und ermordet. 1941 bemächtigten die Nazis sich des Beith Ahawah und machten es zum Hauptquartier der Hitlerjugend.
Beate Berger starb am 20.5.1940 in Kirjat Bialik an Herzversagen.
Ihr Kinder- und Jugenddorf existiert bis heute. Im Ahava Village for Children & Youth leben heute etwa zweihundert Kinder, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, vernachlässigt oder missbraucht wurden, oft traumatisiert sind. Eine Urgroßnichte von Beate schrieb über Beith Ahawah ein Buch und es wurden auch Dokumentarfilme gedreht.
Quellen: United States Holocaust Memorial Museum; Jüdische Pflegegeschichte / Jewish Nursing History – Biographien und Institutionen in Frankfurt am Main“; Wikipedia; https://www.jpost.com/Special-Content/David-Grins-philanthropy-helps-traumatized-children-in-Ahava-Village-585443; Ayelet Bargur: „Ahawah heißt Liebe“ ISBN-10: 3423245212, ISBN-13: 978-3423245210
Gertrude Bergmann
Gertrude Bergmann wurde am 6.7.1894 geboren. Die Krankenschwester floh aus Deutschland und kam am 22.5.1939 in Shanghai an. Für Shanghai benötigte man kein Visum und es war somit für viele Juden aus Deutschland die einzige Möglichkeit, den Nazis zu entkommen.
Allerdings erwartete die Flüchtlinge in Shanghai nicht die ersehnte Freiheit, ein meschenwürdiges Leben und Sicherheit, sondern ein Horror, der extrem zunahm nach dem Ausbruch des Pazifikkrieges und der Ghettoisierung der deutschen Flüchtlinge durch die Japaner. Das Ghetto befand sich zwischen Hafen und wichtigen Fabriken. Damit hatte das Ghetto ein enormes Risiko, bei Luftangriffen auf die Infrastruktur getroffen zu werden. Außerdem verfügten die dortigen Häuser über keine Kanalisation und überwiegend auch nicht über sanitäre Anlagen. Zeugenaussagen aus Shanghai berichteten von Übergriffen der japanischen Polizei, Willkür, Misshandlungen, drakonischen Strafen bei angeblichem Fehlverhalten, sogar Folter. Emigranten wurden von den Japanern zur Zwangsarbeit gezwungen, mussten Aufräumarbeiten leisten oder Gräben zur Verteidigung ausheben. Dr. Hugo Lewinsohn berichtete dort über seine Erfahrungen:
"In meiner Position als Chefarzt des Hongkou-Krankenhauses und der Ambulanz hatte ich einen guten Einblick in den Gesundheitszustand und die hygienischen Bedingungen der im Ghetto lebenden Emigranten. Der zugewiesene Wohnraum war so klein, dass die Räume so überfüllt werden mussten, dass manchmal vier bis sechs Personen in einem Raum unterkommen mussten. Dadurch war die Übertragung der in Shanghai häufig vorkommenden ansteckenden Krankheiten wie Tuberkulose, Typhus, Fleckfieber, Ruhr und Zöliakie sehr groß. Durch die Inhaftierung im Ghetto wurde den meisten Emigranten die Möglichkeit zur Arbeit genommen. Infolge des Pazifikkriegs konnten die Hilfsgelder nicht mehr im erforderlichen Umfang nach Shanghai transportiert werden. Die Versorgung mit lebensnotwendigen Lebensmitteln und Medikamenten war unzureichend, so dass bald Unterernährung und allergische Erkrankungen einsetzten. Öffentliche Parks, Bäder und Erholungsorte waren verboten. Bereits im Sommer 1943 war eine große Zahl von Todesfällen unter den unterernährten Emigranten zu beklagen. Die extrem kalorienarme Ernährung und die geschwächten Körper waren einer ansteckenden Krankheit nicht gewachsen. In den Jahren 1944–1945 verschlechterten sich die Lebensbedingungen noch mehr. Die etwa 16.000 Menschen umfassende Emigrantengemeinschaft von Hongkou hatte einen Rückgang von etwa 3.000 Todesfällen verzeichnet. Dies war eine alarmierend hohe Sterberate. Der Ghettoerlass der Japaner und die daraus resultierende Freiheitsentziehung mit all ihren Folgen erfolgten nach meinem besten Wissen und meiner Erfahrung auf Druck der in Shanghai, China ansässigen deutschen Behörden."
Gertrude Bergmann war also nicht in Sicherheit in Shanghai. Leider gibt es keinerlei genaue Daten zu ihr und Informationen, ob und wie sie Shanghai überlebt hatte.
Quellen: https://www.chinafamilies.net/wp-content/uploads/2021/07/List-of-German-refugees-arrived-in-Shanghai.pdf; file:///C:/Users/hp/Downloads/SHG-2014-Tom-5-6.pdf Sara Bergmann
Am 12. August 1942 forderten die Deutschen die jüdischen Einwohner im Ghetto Sosnowitz auf, sich auf dem Fußballplatz in der Sw.-Jana-Straße zu versammeln. Der Judenrat verbreitete Flugblätter, die verkündeten, dass der Grund für diese Anordnung die Ausgabe neuer Kennkarten an die jüdische Bevölkerung sei.
Die Untergrundbewegung wies die jüdische Bevölkerung an, sich nicht zum Sammelpunkt zu begeben, da es sich in Wahrheit um eine Deportation in ein Vernichtungslager handelte.
Dennoch folgten 26.000 Juden der Anweisung des Judenrates und gingen in die Falle.
Fredka Kozuch und Sara Bergmann, die als Krankenschwestern im jüdischen Krankenhaus arbeiteten und sich in ihren weißen Kitteln frei auf dem Platz bewegen konnten, hatten je drei Kittel angezogen. Die überzähligen Kittel steckten sie Frauen und Müttern zu, die darunter sogar ihre Kinder verstecken konnten.
An diesem Tag spielten sich unglaubliche Szenen ab. Es fand eine Selektion unter der Leitung von Gestapo-Chef Dr. Hans Dreier aus Ostpreußen statt. Die Versammelten wurden in drei Gruppen eingeteilt. In der ersten Gruppe waren Leute, die in kriegswichtigen Betrieben arbeiteten; sie konnten, mit roten Ausweisen ausgestattet, nach Hause gehen.
Bei der Selektion wurden Familien getrennt: Frauen, ältere Männer und Kinder wurden an einem gesonderten Platz, der von SS-Leuten bewacht wurde, konzentriert, um deportiert zu werden.
Kinder wurden von SS-Leuten mit Gewalt aus den Armen ihrer Mütter gerissen, wenn diese rote Arbeitsausweise besaßen, und brutal an den Platz für die „Auszusiedelnden“ gezerrt. Kindern, die sich nicht von ihren Müttern trennen wollten und sich den Gestapo-Leuten wild widersetzten, wurden die Schädel zertrümmert und die Mütter wurden einfach niedergeschossen.
Der Mut zweier Krankenschwestern half, wenigstens vereinzelte Leben zu retten. Ob die beiden Krankenschwestern die Shoa überlebten, ist nicht bekannt. Quelle: United States Holocaust Memorial Museum
Maria wurde am 22.6.1901 in Vilnius geboren. Ihre Eltern waren der Gartenbauingenieur Józef Pawłowicz und die Lehrerin Wanda, geborene Szwykowski. Sie hatte eine jüngere Schwester namens Halina, geboren 1902, die bereits 1929 verstarb, und einen jüngeren Bruder, Jerzy, geboren 1918. Die Familie wohnte eine Weile in Sochumi, wo Maria das Abitur ablegte. 1920 zog die Familie nach Warschau und Maria begann ein Studium, dass sie aber nach einem Jahr abbrach, um die Krankenpflegeschule des Polnischen Roten Kreuzes zu absolvieren. 1923 erhielt sie ihr Krankenpflegediplom und am 9.4.1924 die Anerkennung als staatlich geprüfte Krankenschwester.
Zu dieser Zeit heiratete sie den Berufsoffizier der polnischen Armee Wacław Berka. Das Ehepaar bekam einen Sohn, Mieczysław. Dadurch arbeitete Maria zwar nicht, hatte aber weiter Kontakte zur Schule und Kommilitoninnen. Aus beruflichen Gründen ihres Mannes zog die Familie 1927 nach Krasne nad Usza und kehrte 1931 nach Warschau zurück. Ab September 1931 arbeitete Maria als Krankenschwester in der Gesundheitsabteilung des Innenministeriums und ab 1932 des Sozialministeriums. 1933 musste sie ihre Berufstätigkeit wieder aufgeben, da sie mit ihrem Mann wieder aus beruflichen Gründen nach Dęblin und Vilnius umziehen musste. Sie blieb aber aktiv und war Mitbegründerin des Polnischen Berufskrankenpflegerverbandes in Vilnius. Am 1.9.1936 kehrten sie wieder nach Warschau zurück und sie arbeitete erneut im Ministerium als Organisatorin der Pflegeverwaltung. Außerdem engagierte sie sich im Polnischen Verband der Berufskrankenschwestern und wurde Vorsitzende des Warschauer Kreises.
Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht wurde das gesamte Ministerium mit ihr nach Podhajece Czech in Wolhynien evakuiert. Sie arbeitete dort in Lazaretten. 1940 zog Maria nach Vilnius und hielt sich mit Privatpflegen über Wasser. Ab April 1941 bis zur Auflösung des Tuberkulosekrankenhauses in Tituwienai bei Šiauliai war sie dort Oberschwester und ging dann nach Vilnius zurück.
Ende 1942 zog sie mit ihrem Sohn nach Warschau zu ihrem Mann und schloss sich dem Untergrund an. Maria versorgte unter dem Decknamen „Lucyna“ verwundete Widerstandskämpfer. Ihr Ehemann war unter dem Decknamen „Brodowicz“ Leiter der Nachrichtenabteilung der Armia Krajowa und Verbindungsoffizier zu Offizieren der Roten Armee.
Im Frühjahr 1942 erkrankte er an Tuberkulose und musste erst einmal seine Tätigkeit einstellen, blieb jedoch Berater seines Nachfolgers. Während seiner Behandlung im Sanatorium in Otwock wurde er im November 1943 durch Verrat von der Gestapo verhaftet. Im berüchtigten Gefängnis Pawiak wurde er isoliert und gefoltert und schließlich in das KZ Sachsenhausen deportiert, wo er im August 1944 ermordet wurde. Durch die Verhaftung ihres Mannes war sich Maria über ihre eigene Gefährdung bewusst, wechselte ihren Wohnort und tauchte ab.
Ihr Sohn hatte sich dem Batalion „Zośka“ angeschlossen, eine Einheit der polnischen Pfadfinderbewegung, die während des Warschauer Aufstandes als Teil der Armia Krajowa kämpfte. Das Batalion „Zośka“ gelang es, Gęsiówka zu befreien, das Warschauer KZ. 348 Juden konnten sie so zunächst retten, die überwiegend aus Ungarn und Griechenland stammten. Fast alle Befreiten schlossen sich der Armia Krajowa an. Wie durch ein Wunder überlebte Mieczysław, denn das Batalion „Zośka“ hatte hohe Verluste und nach der Eroberung Polens durch die Rote Armee verschwanden die meisten Mitglieder in sowjetischen Gefängnissen.
Während des Warschauer Aufstands war Maria für die Armia Krajowa aktiv in der Versorgung Verwundeter, arbeitete auch eine Weile in einem Feldlazarett und an Rettungsstützpunkten. Als ihre Kampfeinheit vom „Parasol“- Batalion aufgerieben wurde, war sie nicht unter den Gefangenen. Erst im Frühjahr 1945 wurde eine Leiche gefunden. Durch ihren Ausweis konnte sie als Maria Berka identifiziert werden. Vermutlich starb sie etwa im September 1944. Berichten zufolge, die allerdings nicht bestätigt wurden, soll sie von Deutschen (SS? Gestapo? Wehrmacht?) in Powiśle gehängt worden sein.
Maria Berka wurde auf dem Militärfriedhof Powązki bestattet. Quellen: Encyklopedia Medyków Powstania Warszawskiego; Wikipedia.pl; Muzeum Powstania Warszawskiego; VIA MEDICA; geni.com; Wikipedia (pl)  Cécile Berkowitch, geb. Serebriany Cécile Berkowitch, geb. SerebrianyCécile Serebriany wurde am 10.10.1911 in Brüssel in Belgien geboren. Ihre Eltern hießen Leon Serebriany und Sonja, geborene Bielsky. Sie hatte einen Bruder namens Michel.
Die Krankenpflegerin oder Krankenschwester war mit Max Mordechai Berkovitch verheiratet. Das Ehepaar hatte eine Tochter, Paulette, vielleicht ein weiteres Kind.
Ihr Bruder und ihre Tochter überlebten die Shoa, denn ihre Tochter füllte bei Yad Vashem ihr Gedenkblatt aus. Was mit ihrem Ehemann geschah, konnte ich nicht herausfinden.
Cécile wurde von den Nazis in ihrem Geburtsland als staatenlos erklärt. Die Praxis, Juden als staatenlos einzustufen diente dazu, ausländische Interventionen für die betroffenen Menschen zu unterbinden.
Zunächst verschleppten die Nazis Cécile Berkowitch in das SS-Sammellager Mechelen. Unter der Nummer 925 wurde sie am 15.9.1942 mit dem Transport X nach Auschwitz deportiert. Ein Todesdatum ist nicht bekannt, aber es muss angenommen werden, dass Cécile Berkovitch den Holocaust nicht überlebte. Quellen: Ich danke für die Recherche Frau Laurence Schram vom Jüdischen Deportations- und Widerstandsmuseum (JDWM) in der ehemaligen Mechelner Dossinkaserne; Yad Vashem; geni.com
Grace Berkowitz
In dieser Brigade waren sehr viele Brigadisten links eingestellt, also überwiegend Kommunisten, Sozialisten, Sozialdemokraten oder Anarchisten. Dazu kamen auch vereinzelt christliche Pflegekräfte, die aus humanitären Gründen das republikanische Spanien unterstützten. Allerdings schlossen sich auch auffallend sehr viele Juden und Jüdinnen der Brigade an, besonders diese mit europäischen Wurzeln, die vor Pogromstimmungen in ihren Herkunftsländern in die USA geflüchtet waren. Ihr Motiv war in erster Linie der Kampf gegen den Faschismus und dem damit verbundenen Antisemitismus. Vermutlich gehörte Grace zu dieser Gruppe angesichts ihres Geburtsortes.
Sie arbeitete für die Internationale Brigade im Krankenhaus Murcia. Kolleginnen und Kollegen von ihr verspotteten Grace als prüde alte Jungfer und behaupteten, dass sie sich geweigert hätte, nackte Männer zu pflegen. Da prallten wohl unterschiedliche Generationen und kulturelle Vorstellungen aufeinander.
Nach heutigen Erkenntnissen ist die Scham eine eigene Basisemotion oder zumindest Bestandteil der Basisemotionen Angst, Verachtung, Überraschung und Wut. Scham ist keineswegs pathologisch, sondern eine Ressource. Vielleicht hatten daher auch verwundete Soldaten, die von ihr gepflegt wurden, es eher als wohltuend empfunden, dass Grace ihr eigenes Schamgefühl, aber auch das der Patienten, beachtete.
Dass sie sich geweigert haben soll, unbekleidete Männer zu pflegen, ist mehr wie unwahrscheinlich, denn sie wusste bereits vorher sehr genau, auf was sie sich eingelassen hatte. Denn sie hatte bereits im I. Weltkrieg vom 1.10.1917 bis zum 13.7.1919, also fast zwei Jahre, als Krankenschwester beim Militär gearbeitet. Am 29.8.1919 wurde sie ehrenhaft entlassen und ganz bestimmt nicht, weil sie sich dort geweigert hätte, verletzte nackte Soldaten zu pflegen.
Junge Pflegekräfte mit einem gewissen jugendlichen Leichtsinn und Abenteuerlust im Gepäck traten ihre Reise in den spanischen Bürgerkrieg sicherlich etwas unbekümmerter an. Aber Grace war sich mit Sicherheit voll darüber bewusst, dass ein Kriegsgebiet keine Kinderkrippe ist. Mit diesem Wissen und ihren bisherigen Erfahrungen sich mit 50 Jahren noch einmal freiwillig in ein Kriegsgebiet zu begeben, ist schon sehr erstaunlich.
Von daher sehe ich persönlich die Beschreibung ihrer Person durch die Kollegen und Kolleginnen als sehr zweifelhaft an. Diese Charakterisierung auch noch bei ALBA (Archiv der Abraham Lincoln Brigade) unkommentiert zu veröffentlichen empfinde ich als mehr wie gewagt, absolut unpassend und diskriminierend, was ich so auch nicht kommentarlos stehen lassen kann.
In Spanien wurde Grace krank. Es wurde bei ihr ein rheumatisches Fieber diagnostiziert, eine Autoimmunreaktion, die meist einige Wochen nach einer Streptokokken-Infektion auftritt. Da an ihrem Arbeitsplatz die hygienischen Bedingungen nicht unbedingt allgemeinen Standards entsprachen, hatte sie sich wahrscheinlich in Murcia angesteckt. Unter den Spätfolgen eines rheumatischen Fiebers können Betroffene noch Jahre bis Jahrzehnte lang leiden. Auf ärztliche Empfehlung musste Grace daher ihren Einsatz in den Internationalen Brigaden am 31.5.1938 abbrechen und kehrte an Bord der Ile de France in die USA zurück.
Sie war sehenden Auges nach Spanien gereist, war sich der Gefahren bewusst und steckte den Spott ihrer Kolleginnen und Kollegen weg, war bereits durch ihr Alter unfreiwillig eher in eine Außenseiterrolle gedrängt und folgte dennoch ihrer Überzeugung und ihrem Gewissen. Für mich persönlich ist sie eine große Persönlichkeit und Heldin der Internationalen Brigaden.
Grace Berkowitz starb am 25.9.1973 im Alter von 86 Jahren in Bronx, einem Stadtteil von New York, der dazumal als sozialer Brennpunkt galt und nicht unbedingt eine Vorzeigeadresse war. Quellen: Archiv der Abraham Lincoln Brigade; Internationale Frauen im Spanischen Krieg 1936 – 1939; SIDBRINT Emilie Berlin, geb. Maas
Emilie Berlin, geborene Maas am 7.11.1856 in Fürth geboren. Ihre Eltern waren Jakob und Amalie, geborene Lafo. Sie heiratete den Kaufmann Louis Berlin am 18.9.1876 in Mannheim. Das Ehepaar lebte zuletzt in Lambsheim bei Mannheim und bekam fünf Kinder. Ihre Töchter waren Jeanette, geboren am 7.9.1877, und Amalie, geboren am 22.8.1878. Die Söhne hießen Otto, geboren am 26.9.1879, Martin, geboren am 16.12.1885, und Philipp, geboren am 1.2.1887.
Ihr Sohn Martin starb kurz nach der Geburt, die anderen Kinder überlebten die Shoa. Allerdings war Tochter Jeanette am 4.9.1944 mit dem Transport XXIV/7 vom Durchgangslager Westerbork nach Theresienstadt deportiert worden und starb neun Monate nach ihrer Befreiung an den katastrophalen Zuständen dort.
Es ist nicht bekannt, ob und welchen Beruf Emilie hatte. Auf jeden Fall hatte sie im I. Weltkrieg im Lazarettdienst gearbeitet, denn im April bekam sie das König-Ludwig-Kreuz für Heimatverdienste während der Kriegszeit, im Oktober 1916 das Dienstauszeichnungskreuz für freiwillige Krankenpflege und am 12.12.1920 die preußische Rot-Kreuz-Medaille III. Klasse verliehen.
Unter dem zunehmenden Terror der Nationalsozialisten emigrierte Emilie 1939 in die Niederlande. Dort wohnte sie in Amsterdam, Daniël Willinkplein 9, heute Victorieplein.
Dort geriet sie nach der Besetzung der Niederlande wieder in die Fänge des braunen Mobs und wurde in das KZ Westerbork verschleppt, wo Emilie Berlin am 19.7.1943 durch die Strapazen starb.
Quelle: Israelitische Kultusgemeinde Fürth Memorbuch; Joods Monument; Yad Vashem; http://alemannia-judaica.de/ lambsheim_synagoge.htm Golda Berliner, geb. Luftig
In Antwerpen politisierten sich die Geschwister, gehörten dem kommunistischen jüdischen Emigrantenclub Farein an und lösten sich von den religiösen Vorstellungen ihrer frommen Eltern. Im Farein lernte Golda Samuel Berliner, genannt Szmul, kennen. Etwa um 1932 heirateten sie. Als im Juli 1936 in Spanien das Militär unter Franco gegen die demokratisch gewählte republikanische Regierung putschte, ging Szmul mit seinem Schwager Emiel Akkerman und Schwager in spe Elias François Goth nach Spanien, um sich der Internationalen Brigade anzuschließen. Im Mai 1937 folgte Golda ihm mit einer Gruppe von Frauen, darunter ihre Schwestern Rachel und Feigla, die die Reise organisiert hatte.
Golda arbeitete wie ihre Schwestern im Hospital El Belga in Ontentiente als Hilfsschwester, heute würde man es als Krankenpflegehelferin bezeichnen. Dort freundete sie sich mit einer Kollegin an, Cyla Vospe (siehe dort), eine Jüdin aus Lettland, die dort bereits seit zwei Monaten arbeitete. Cyla wollte in Albacte ihren Freund Dr. Jakob Bachrach, genannt Kuba, besuchen, der Chefarzt des medizinischen Dienstes der Baisse von Albacete war. Dort hielt sich auch Goldas Ehemann auf. So nahmen sich die beiden Frauen Urlaub und reisten zusammen nach Albacete.
Am 2.8.1938 kam in Onteniente Goldas und Szmuls Sohn Madrich zur Welt. Golda verließ mit ihrem Sohn Spanien über Algerien, damals noch französische Kolonie, und kam so nach Antwerpen zurück.
1942 geriet die Familie in eine Razzia der Nazis und wurden im SS-Sammellager Mecheln interniert. Am 1.9.1942 wurden sie in das Vernichtungslager Auschwitz mit Transport VII deportiert, Golda mit der Nummer 175, ihr kleiner Sohn als Nummer 176. Was mit Szmul geschah, konnte ich nicht herausfinden.
Es muss davon ausgegangen werden, dass Golda Berliner und ihr kleiner Sohn Madrich nach der Ankunft in Auschwitz sofort in eine Gaskammer getrieben und ermordet wurden.
Auch Goldas Mutter und ihre Schwester Miriam, die in Frankreich verheiratet war, wurden in Auschwitz ermordet.
Quellen: Geni.com; Yad Vashem; Le Maitron https://maitron.fr/; Internationale Frauen im Spanischen Krieg 1936 – 1939 https://internationale-frauen-im-spanischen-krieg-1936-1939.de/; https://sidbrint.ub.edu/ca/node/26528 Universi-tat de Barcelona  Klara Berlinger, geb. Roberg Klara Berlinger, geb. RobergKlara Roberg wurde am 16.11.1905 in Baden-Württemberg geboren. Ihre Eltern waren der Kaufmann und Kultusbeamte der Israelitischen Gemeinde Berlichingen Uri Shraga Roberg, geboren 1874, und Ernestine, geborene Hanauer am 6.4.1874. Klaras jüngere Geschwister waren Julius, geboren am 23.4.1907, Helena, geboren am 6.6.1908, Shulamit (Frida), geboren am 13.2.1911, בתיה פסלה ברבל, geboren am 24.2.1912, und Alexander, geboren am 2.4.1914. Für die gesamte Familie lautete der Geburtsort Berlichingen.
Über Klaras Schulbildung und ihre Ausbildung zur Krankenschwester ist bisher nichts bekannt, auch nicht, ob und wo sie als Krankenschwester arbeitete. Sie heiratete am 24.6.1930 Eliezer Berlinger, geboren am 14.7.1904 ebenfalls in Berlichingen. Sehr schnell begriffen sie und ihr Mann, dass sie keine Zukunft in Deutschland haben und wanderten 1936 nach Palästina aus. Ihre ersten von insgesamt elf Kindern wurden noch in Deutschland geboren. Auch ihrer Schwägerin, der Krankenschwester Hannah Brillemann, geborene Berlinger (siehe dort), gelang die Auswanderung nach Palästina. Klaras Geschwister konnten ebenfalls nach Palästina, Großbritannien oder USA flüchten bis auf ihre Schwester Helena (siehe Helena (Helene) Roberg), ebenfalls Krankenschwester, die in Sobibor ermordet wurde.
Klara Berlinger starb am 1.12.1956 in Israel.
Quellen: Alemannia Judaica; geni.com; Biographische Datenbank Jüdisches Unterfranken Elisabeth Bernheim
Elisabeth Bernheim wurde am 20.8.1920 in Riedlingen geboren. Ihre Eltern waren Albert, geboren 1885 in Buchau, und Irma Bernheim, geborene Oettinger 1893 in Riedlingen. Elisabeth hatte zwei jüngere Brüder. Erich, der sich später Eric nannte, wurde am 9.7.1922, Kurt am 19.2.1931 geboren. Die Eltern betrieben in Riedlingen am Marktplatz 15 ein Textilgeschäft, dass sie von Irmas Vater Ernst Oettinger übernommen hatten. Zu dem Geschäft gehörte noch ein Magazingebäude in der Mühlgasse 3. Da Albert Bernheim auch Geschäfte in den umliegenden Dörfern mit seinen Waren belieferte, besaß die Familie schon sehr früh ein Auto. Elisabeths Mutter half im Geschäft neben zwei bis drei Angestellten.
Schleichend hatte sich nach der Machtergreifung die Bedrohung entwickelt. Der Boykott jüdischer Geschäfte war im April 1933 nur ein Auftakt. Die Kunden betraten oder verließen danach lieber durch die Hintertür das Geschäft. Die Kinder wurden von einigen Sportveranstaltungen, die am Samstag stattfanden, ausgeschlossen. Bestimmte Klassenkameraden mieden die Bernheimkinder. Die Eltern erkannten die Gefahr, versuchten, zu emigrieren. Sie hätten zwei Zertifikate zum Preis von jeweils 1000 Dollar nach Palästina erhalten können. Weil das Geschäft nicht so kurzfristig verkauft werden konnte und das Bargeld fehlte, konnten die Eltern nicht zugreifen.
Von 1932 bis 1935 besuchte Elisabeth Bernheim die Riedlinger Lateinschule. Anschließend absolvierte sie vom Oktober 1935 bis September 1936 die jüdische Frauenfachschule in Wolfratshausen. 1937 ging sie nach Bad Freienwalde und arbeitete dort ein Jahr als Sprechstundenhilfe bei dem jüdischen Arzt Dr. Fritz Happ. Anschließend besuchte sie das Kindergärtnerinnenseminar von Nelly Wolffheim in Berlin-Charlottenburg. Am 1. März 1939 wurde die Einrichtung geschlossen.
Elisabeths Eltern schickten den jüngeren Bruder Erich 1935 auf ein deutsch-jüdisches Internat in Südschweden, um ihm eine schulische Ausbildung ohne Repressalien bieten zu können. Nachdem der fünfjährige Kurt 1936 in der örtlichen Presse angegriffen wurde, weil sich das Kind „deutschfeindlich“ geäußert habe, brachten die Eltern ihn zu seiner Sicherheit in ein Kinderheim im Schwarzwald.
Die Pogromnacht lief zunächst für die Bernheims glimpflich ab. Ihr Geschäft wurde auf Anordnung des Bürgermeisters von Polizisten bewacht. Kein Wunder, denn kurze Zeit später beschlossen die Eltern, beizugeben und das Geschäft zu verkaufen. Der Käufer war ein hohes Tier bei den örtlichen Nazis. Bevor die Eltern am 10.1.1939 in ein Mietshaus nach Stuttgart umziehen mussten, gelang es ihnen, ihre drei Kinder nach England zu schicken.
Im Frühjahr 1939 kam Kurt mit einem Kindertransport nach England und fand Aufnahme bei einer Familie Lennard im Londoner Stadtteil Hampstead Heath. Kurz darauf kam auch Elisabeth, die als Haushaltshilfe und Kindermädchen zu einer Familie nach Edinburgh ging. Ein Jahr vorher war ihre Cousine Eva Oettinger nach Großbritannien emigriert, von der sie die Stellung übernehmen konnte. 1943 zog sie nach Leeds, weil ihr Bruder dort lebte und arbeitete als Verkäuferin. Schließlich begann sie eine Ausbildung zur Hebamme.
Ihr jüngerer Bruder Erich entkam am 27.8.1939 aus Nazideutschland. Kurz danach war die Grenze nach England durch den Kriegsausbruch dicht. Er meldete sich später freiwillig zu einer jüdischen Brigade und begann im Juli 1945 in Stuttgart die Suche nach den Eltern. Im September 1946 erfuhren die Geschwister vom Suchdienst des Roten Kreuzes, dass ihre Eltern am 1.12.1941 nach Riga deportiert worden waren. Im April 1947 berichtete ihnen eine Überlebende, dass die Mutter vermutlich am 26.3.1942 dort erschossen wurde. Den Vater hatte man im Juli 1943 nach Auschwitz deportiert und ermordet. Elisabeth Bernheim blieb in Leeds und arbeitete dort als Hebamme fast 30 Jahre.
Quellen: Erich Bernheim: Mein Leben bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Hg. und übersetzt von Christoph Knüppel (Erinnerungen, die Erich Bernheim aus Riedlingen im Dezember 1982, kurz vor seinem Tod für seine Angehörigen niederschrieb); Yad Vashem; geni.com
Henriette Bernheim, geb. Gombertz
Dort wurden sie nach der Besetzung Belgiens von den Nazis gefasst, als staatenlos erklärt und im SS-Sammellager Mecheln interniert. Am 15.9.1942 wurde Henriette Bernheim unter der Nummer 992 mit dem X. Transport nach Auschwitz deportiert, wo sich ihre Spur verliert.
Ihr Ehemann wurde am 7.10.1942 in Auschwitz ermordet. Auch ihr Sohn Wolfgang kam in Auschwitz ums Leben. Nur ihre Tochter Roselies überlebte die Shoa und lebt heute in Brüssel. Quellen: Ich danke für die Recherche Frau Laurence Schram vom Jüdischen Deportations- und Widerstandsmuseum (JDWM) in der ehemaligen Mechelner Dossinkaserne; Kulturverein Kürenz e.V., Dr. Thomas Schnitzler, Arbeitsgemeinschaft Frieden e.V. Trier, Stolpersteine in Trier; Yad Vashem; geni.com  Rosa Bernstein Rosa BernsteinRosa Bernstein wurde am 29.8.1865 in Bollinken bei Stettin geboren. Ihre Eltern waren Max und Johanna Bernstein. 1897 absolvierte sie die Ausbildung zur Krankenschwester im Frankfurter Jüdischen Schwesternverein. Sie gehörte zu den ersten ausgebildeten jüdischen Krankenschwestern Deutschlands und zur Frankfurter Gründerinnengeneration der beruflichen jüdischen Krankenpflege. Als Klara Gordon 1898 nach Hamburg zur Oberin berufen wurde, folgte ihr Rosa Bernstein.
Über 40 Jahre arbeitete sie aktiv im Israelitischen Krankenhaus als examinierte Krankenschwester. Das Krankenhaus auf St. Pauli galt jahrzehntelang als eines der modernsten und fortschrittlichsten Krankenhäuser und genoss bei der Hamburger Bevölkerung, egal welche Konfession, einen guten Ruf. Zunächst war Rosa dort als Angestellte geführt, dann als Krankenpflegerin und schließlich als Oberschwester.
Bis zum September 1939 lebte sie im Schwesternheim. Dann wurde das Krankenhausgelände von der Stadt Hamburg beschlagnahmt. Die verbliebenen Ärzte und Krankenschwestern zogen mit den restlichen Patienten in die ehemalige Calmannsche Privatklinik, auch Rosa, obwohl sie inzwischen im Ruhestand war. Doch auch dort wurden sie vertrieben und mussten Ende August 1942 in das jüdische Pflege- und Siechenheim umziehen.
Am 23.6.1943 wurde die 78jährige von Hamburg nach Theresienstadt mit dem Transport VI/8 unter der Deportationsnummer 11 deportiert. Dort starb Rosa Bernstein durch die grausamen Bedingungen am 11. März 1944. Quellen: Film "Den Nazis ein Dorn im Auge"; Das Israelitische Krankenhaus Hamburg (St.Pauli) im Nationalsozialismus; von Bertram Rotermund und Rudolf Simon; Stolpersteine Hamburg; Israelitisches Krankenhaus in Hamburg; Yad Vashem
Gratis Homepage von Beepworld Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular! |
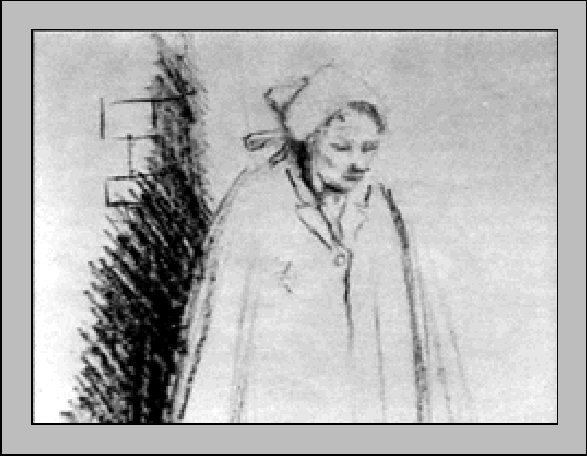
 Elsie Berg wurde am 25.2.1923 in Köln geboren. Ihr Vater war der Brauereibesitzer Eduard Richard Berg, geboren am 28.4.1885 in Kassel, der bereits 1927 starb. Ihre Mutter hieß Frederika Elisabeth, geborene Hanf am 6.6.1895 in Witten.
Elsie Berg wurde am 25.2.1923 in Köln geboren. Ihr Vater war der Brauereibesitzer Eduard Richard Berg, geboren am 28.4.1885 in Kassel, der bereits 1927 starb. Ihre Mutter hieß Frederika Elisabeth, geborene Hanf am 6.6.1895 in Witten. Beate Berger wurde 1886 in Niederbreisig in Rheiland-Pfalz geboren. Ihre Eltern waren der Wein- und Getreidehändler Jonas Berger und Henriette (Jatia), geborene Pelzer. Das Ehepaar hatte fünf Kinder. Circa 1892 starb der Vater und die Mutter war alleine mit den fünf Kindern überfordert. So schickte sie Beate zu Verwandten in ein Bergdorf. Für Beate war das Gefühl, abgeschoben zu werden, schlimm und prägend.
Beate Berger wurde 1886 in Niederbreisig in Rheiland-Pfalz geboren. Ihre Eltern waren der Wein- und Getreidehändler Jonas Berger und Henriette (Jatia), geborene Pelzer. Das Ehepaar hatte fünf Kinder. Circa 1892 starb der Vater und die Mutter war alleine mit den fünf Kindern überfordert. So schickte sie Beate zu Verwandten in ein Bergdorf. Für Beate war das Gefühl, abgeschoben zu werden, schlimm und prägend. Maria Berka, geb. Pawłowicz
Maria Berka, geb. Pawłowicz Grace Berkowitz wurde am 18.5.1887 in Minsk in Russland, heute Belarus, geboren. Die ledige Krankenschwester lebte in Brooklyn, New York in den USA, 404 Hart Street. Im März 1937 erhielt sie ihren Reisepass mit der Passnummer 378162 und schloss sie sich der Abraham Lincoln Brigade an.
Grace Berkowitz wurde am 18.5.1887 in Minsk in Russland, heute Belarus, geboren. Die ledige Krankenschwester lebte in Brooklyn, New York in den USA, 404 Hart Street. Im März 1937 erhielt sie ihren Reisepass mit der Passnummer 378162 und schloss sie sich der Abraham Lincoln Brigade an. Golda Luftig wurde am 3.3.1903 in Chrzanów in Polen geboren und war die Schwester von Faigla Akkerman (siehe dort), Miriam und Rachel Goth (siehe dort). Ihr Vater Moses Luftig reiste 1927 nach Antwerpen in Belgien und holte peu a peu seine fünf Kinder und Ehefrau nach. 1933 wohnte die gesamte Familie in Antwerpen.
Golda Luftig wurde am 3.3.1903 in Chrzanów in Polen geboren und war die Schwester von Faigla Akkerman (siehe dort), Miriam und Rachel Goth (siehe dort). Ihr Vater Moses Luftig reiste 1927 nach Antwerpen in Belgien und holte peu a peu seine fünf Kinder und Ehefrau nach. 1933 wohnte die gesamte Familie in Antwerpen. Henriette Gombertz wurde am 8.1.1902 in Krefeld geboren. Die Krankenpflegerin heiratete Ernst Bernheim, geboren am 6.8.1888 in Trier. Das Ehepaar hatte zwei Kinder, Sohn Wolfgang, geboren am 8.2.1928, und Tochter Roselies, geboren 1932. Die Familie flüchtete vor den Nazis nach Belgien.
Henriette Gombertz wurde am 8.1.1902 in Krefeld geboren. Die Krankenpflegerin heiratete Ernst Bernheim, geboren am 6.8.1888 in Trier. Das Ehepaar hatte zwei Kinder, Sohn Wolfgang, geboren am 8.2.1928, und Tochter Roselies, geboren 1932. Die Familie flüchtete vor den Nazis nach Belgien.