Virtuelles Denkmal "Gerechte der Pflege""... die tolldreisten, machthungrigen Horden, sie konnten den Geist nicht morden!"
Evelyn Florence wurde am 18.11.1907 in Brooklyn, New York, geboren. Ihre Eltern Eyvind Randolf Andal, geboren 1878, und Emma H., geborene Petersdtr 1880, stammten aus Bergen in Norwegen.
Evelyns Nachname wirft Fragen auf. Der Familienname Andal in Andahl könnte eventuell mit der Emigration der Eltern in die USA zusammenhängen. Der Familienname Andell ist bisher nicht erklärbar, denn auf ihrem Grabstein steht eindeutig Evelyn F. Andahl neben dem Namen ihrer Mutter, die an gleicher Stelle begraben wurde.
Ihre Krankenpflegeausbildung absolvierte Evelyn am St. Luke's Hospital in San Francisco, Kalifornien.
Am 17.1.1938 erhielt Evelyn ihren Reisepass mit der Nummer 493531. Laut Pass wohnte sie zu desem Zeitpunkt in Sausalito, 248 West Street, nahe San Francisco. Mit dem Schiff Lafayette reiste sie nach Spanien, um sich den Internationalen Brigaden anzuschließen. In Spanien kam sie am 5.2.1938 an. Sie arbeitete im Amerikanischen Krankenhaus von Villa Paz, im Krankenhaus von Barcelona, Mataró und in der Militärklinik Nr. 7. Oft assistierte sie Dr. Leo Eloesser, einem bekannten Thoraxchirurgen, in seinem eigenen mobilen chirurgischen Krankenhaus bei Operationen. Er war wie sie als Freiwilliger für das Abraham Lincoln-Bataillon in Spanien tätig.
Evelyn wurde als mutiger Mensch beschrieben. Sie soll auch gelegentlich einen Krankenwagen gefahren haben. Nach ihrer Evakuierung aus Spanien am Kriegsende reiste sie zunächst in die alte Heimat ihrer Eltern nach Bergen und anschließend zurück in die USA.
Evelyn Florence Andahl starb am 16.8.1998 in Kalifornien.
Quellen: Internationale Frauen im spanische Krieg 1936 – 1939; SIDBRINT; The Abraham Lincoln Brigade Archives; Ancestry
Ena Andry, geb. Ferwerda
Ena Ferwerda wurde am 10.7.1906 geboren und stammte aus New York aus einer gutsituierten Familie. Ihre Eltern waren Floris Thomas Ferwerda und May Ferwerda, ihre Stiefmutter Marie W Ferwerda. Sie hatte eine Schwester und sechs Halbgeschwister. Die Krankenpflegeausbildung machte sie an der Bellevue Nursing School.
Die jüdische Krankenschwester der Abraham Lincoln Brigade kam im April 1937 nach Spanien. Sie arbeitete in Murcia. Aus gesundheitlichen Gründen wurde sie am 9.2.1938 nach Hause geschickt. Später heiratete sie den Seemann und Truckfahrer Lester Andry, geboren am 28.2.1911, und ebenfalls ein Veteran der Internationalen Brigaden.
1957 bekam sie in Amerika Schwierigkeiten für ihren pflegerischen Einsatz bei den Internationalen Brigaden. Sie wurde von ihrem Arbeitgeber, das Veteranen Hospital in Togus, suspendiert aufgrund ihrer "subversiven" Tätigkeit in Spanien. Nach einigen Monaten wurde ihr eine Anhörung gewährt, bei dem sie ihren Pass zeigte, der mit "gültig für Spanien" gestempelt war. Sie war also nicht illegal in Spanien und hatte kein Reiseverbot. Ena gewann ihren Prozess und musste wieder eingestellt werden mit rückwirkender Lohnzahlung. Soviel Glück mit einer fairen Verhandlung und Gerechtigkeit hatten nicht alle amerikanischen Interbrigadisten.
Ena Andry starb am 16.12.1971.
Quelle: Martin Sugarman, AJEX - Jewish Military Museum; American Medical Relief to Spain and China, 1936–1949 ISBN-13: 978-0826221070 ISBN-10: 0; Geni; findagrave.com
Carola Anfänger, geb. Oberndörfer
Über diese Krankenschwester gibt es leider keine genauen Informationen. Karola Oberndörfer wurde vermutlich 1910 in Rothenburg o.d.T. geboren. Die Informationen zu ihr stammen hauptsächlich aus einem Kündigungsschreiben vom 25.6.1933 vom "Verein für jüdische Krankenpflegerinnen" in Berlin-Wedding. Hintergrund ihrer Kündigung waren die Repressalien der Nazis gegen das Jüdische Krankenhaus Berlin. Ab dem 15.6.1933 durfte das Krankenhaus keine sogenannten christlichen oder jüdischen Wohlfahrtspatienten mehr aufnehmen. Damit war das Krankenhaus nicht mehr ausgelastet und musste aus wirtschaftlichen Gründen den Gestellungsvertrag mit dem "Verein für jüdische Krankenpflegerinnen" Berlin-Wedding auflösen. Dadurch war der Verein gezwungen, Carola Oberndörfer zu kündigen, die im Jüdischen Krankenhaus seit 1931 auf der Entbindungsstation und gynäkologischen Abteilung gearbeitet hatte. Zum Zeitpunkt der Kündigung war sie in Rothenburg o.d.T., Galgengasse 27 I gemeldet.
Nach der Kündigung wechselte sie nach Frankfurt am Main und arbeitete dort bis etwa 1936. Dann hatte sie die Chance, mit Kolleginnen nach Palästina auszuwandern. Wo und wann sie heiratete, ist bisher nicht bekannt. Vermutlich hatte sie zumindest einen Sohn Michael, der dem Jüdischen Museum Berlin das Kündigungsschreiben vom "Verein für jüdische Krankenpflegerinnen" in Berlin-Wedding übergab.
In Palästina, später Israel, arbeitete sie in ihrem Beruf weiter und war zuletzt Oberschwester in Jerusalem. Sie besuchte 1959 ihre ehemalige Heimatstadt Rothenburg o.d.T. und war sehr enttäuscht. 1992 folgte sie einer Einladung von Oberbürgermeister Hachtel von Rothenburg o.d.T. und nahm von ihrem zweiten Besuch wesentlich bessere Eindrücke von der Stadt mit nach Hause.
Carola Anfänger soll im Jahr 2000 in Israel gestorben sein.
Quellen: Jüdisches Museum Berlin; Gemeindeblatt der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, July 1933; Franconia Judaica: Geschichte und Kultur der Juden in Rothenburg o.d.T.
Fanny Ansbacher
Fanny Ansbacher wurde am 11.5.1921 in Würzburg geboren. Ihr Vater hieß Simon, „Simcha“ genannt, geboren am 11.9.1885 ebenfalls in Würzburg. Ihre Mutter Selma Shulamit stammte aus Österreich, geborene Obermeyer am 15.7.1892 in Neulengbach. Sie hatte drei Geschwister, ihren älteren Bruder Yona oder Jonas, geboren 12.7.1920, und zwei jüngere Geschwister. Ihre Schwester Rebekka, „Rivka“ gerufen, wurde am 22.8.1922 geboren. Der jüngere Bruder Nathan kam am 25.4.1925 zur Welt.
Die Familie wohnte in der Würzburger Altstadt in der Sterngasse. Fanny besuchte nach der jüdischen Volksschule die Israelitische Lehrerbildungsanstalt in Würzburg und war Mitglied im jüdischen Kulturbund. Ab 1937 bereitete sie sich auf die Auswanderung nach Palästina vor und machte deshalb eine landwirtschaftliche Ausbildung in Hamburg und Halberstadt in Sachsen-Anhalt mit.
Die Auswanderung gelang nicht und so absolvierte sie von Mai 1940 bis Februar 1941 eine Ausbildung als Krankenschwester am Rothschild-Hospital in Frankfurt am Main. Vielleicht hatte sie gehofft, als Krankenschwester ihre Chancen für eine Auswanderung verbessern zu können. Doch sie musste anschließend in Berlin Zwangsarbeit in den Siemens-Werken verrichten.
Ihre Familie versuchte sich zu retten und hielt sich in Belgien auf. Der Vater trennte sich von Frau und den beiden jüngeren Geschwistern von Fanny. Vielleicht war er auf der Suche nach einem sicheren Ort. Er wurde verhaftet und im Camp de Gurs inhaftiert. Von dort wurde er über Drancy am 5.8.1942 nach Auschwitz deportiert.
Ihre Mutter und die jüngeren Geschwister wurden in Belgien gefasst, kamen in das SS-Sammellager Mecheln und wurden am 15.8.1942 ebenfalls nach Auschwitz verschleppt. Das war das letzte Lebenszeichen der jüngeren Geschwister und der Eltern.
Lediglich ihr älterer Bruder konnte entkommen und starb 1991 in Israel. Fanny selber wurde am 3.3.1943 von Berlin aus in das KZ Auschwitz deportiert. Dort musste sie im Revier als Krankenpflegerin arbeiten. Dabei steckte sie sich mit Typhus an. Mangels medizinischer Versorgung starb Fanny Ansbacher noch 1943 in diesem KZ. Ein genaues Sterbedatum existiert nicht.
Heute erinnern Stolpersteine in Würzburg, Sterngasse 16, an die Familie.
Quellen: Reiner Strätz, Dr. Hans-Peter Baum und Stadtarchiv Würzburg; Stolpersteine Würzburg; Yad Vashem; Bundesarchiv Gedenkbuch; geni.com
Rebekka, Rivka Ansbacher
Rebekka oder Rivka Ansbach wurde am 22.8.1922 in Würzburg geboren. Sie war die jüngere Schwester von Fanny Ansbach (siehe dort).
Nach Aussage ihres ältesten Bruders, der als Einziger der Familie die Nazizeit überlebte, war sie von Beruf Kinderpflegerin.
Rivka wurde mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder am 15.8.1942 vom SS-Sammellager Mecheln nach Auschwitz verschleppt.
Seitdem fehlt jedes Lebenszeichen von Rebekka „Rivka“ Ansbach.
Quellen: Reiner Strätz, Dr. Hans-Peter Baum und Stadtarchiv Würzburg; Stolpersteine Würzburg; Yad Vashem; Bundesarchiv Gedenkbuch; geni.com
Halina Brzozowska wurde am 4.3.1899 in Marszensk geboren. Ihre Eltern waren Wladyslaw und Aleksandra Brzozowska. Nach ihrer Schulzeit bis 1918 lebte sie in Vilnius und St. Petersburg zu Studien, arbeitete auch im Büro. In Vilnius hatte sie bereits einen Sanitätskurs abgelegt und in der Pflege gearbeitet.
1918 kehrte sie nach Polen zurück. Halina nahm bereits am polnisch-sowjetischen Krieg 1919/1920 als Sanitäterin teil. 1921 wurde in Warschau die erste Krankenpflegeschule eröffnet. Sie begann dort ihre Ausbildung zur Krankenschwester und gehörte zu den ersten Absolventinnen der Warszawskiej Szkoly Pielegniarstwa.
Bereits vor dem Ausbruch des II. Weltkrieges kümmerte sie sich um den Aufbau von Rettungsdiensten. 1929 wurde sie mit der Medaille des X-Jahrestages der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Polens geehrt, 1938 mit der Bronzemedaille "Für den langfristigen Dienst".
Bei Kriegsausbruch trat sie der Armia Krajowa bei. Sie engagierte sich im Rat und war beteiligt an der Ausstellung fiktiver Personalausweise. 1940 wurde sie von der Gestapo verhaftet. Sie wurde im Pawiaku inhaftiert, ein berüchtigtes Gefängnis für politische Häftlinge im Zentrum von Warschau. Trotz brutaler Verhöre und Folterungen blieb sie standhaft und verriet niemanden.
1943 bis 1945 nahm sie eine jüdische Frau auf und tarnte sie als Babysitterin, um sie vor einer Deportation zu schützen. Am Warschauer Aufstand nahm Halina Antonowicz aktiv teil. Es gelang ihr, nach der Kapitulation mit Zivilisten Warschau zu verlassen.
Nach dem Krieg arbeitete sie zunächst als Krankenschwester im 3. Gesundheitszentrum, der Fakultät für Sozialmedizin, im Gesundheits- und Sozialzentrum. Die regierenden Kommunisten in Polen verleumdeten und bekämpften die Armia Krajowa. Ein Opfer dieser Politik war Halina Antonowicz. Sie wurde aufgrund ihrer Vergangenheit professionell degradiert und musste 26 Jahre lang bis zum Ruhestand als Laborantin arbeiten. Halina Antonowicz starb am 5.8.1986.
Quelle: Encyklopedia Medyków Powstania Warszawskiego; Wikipedia.pl; Muzeum Powstania Warszawskiego; VIA MEDICA
Eigene Webseite von Beepworld Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular! |
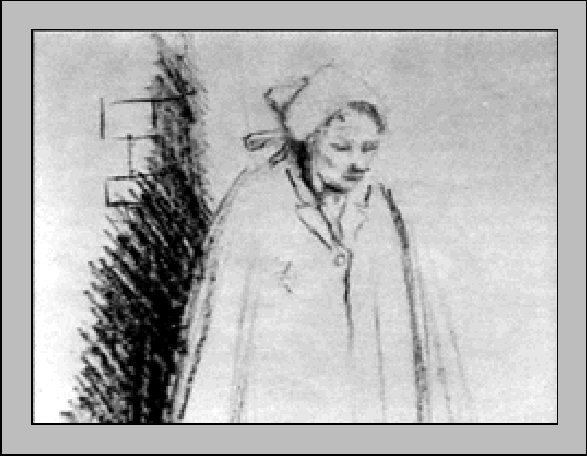
 Evelyn Florence Andahl (Andell)
Evelyn Florence Andahl (Andell) Halina "Korab" Antonowicz, geb. Brzozowska
Halina "Korab" Antonowicz, geb. Brzozowska