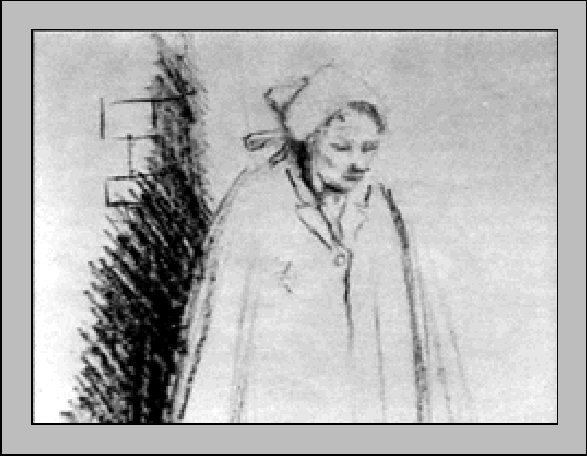Virtuelles Denkmal "Gerechte der Pflege""... die tolldreisten, machthungrigen Horden, sie konnten den Geist nicht morden!"Sara Baskin, geb. Karfounkel
Sara Karfounkel wurde am 1.3.1883 in Poltava in der Ukraine geboren. Ihr Ehemann hieß Hitel Baskin. Als sogenannte Staatenlose wurde sie im SS-Sammellager Mechelen interniert. Die Krankenschwester wurde am 12.9.1942 unter der Nummer 460 mit dem IX. Transport nach Auschwitz verschleppt. Dort wurde sie nicht registriert. Da Sara Baskin über 50 Jahre alt war, muss davon ausgegangen werden, dass sie direkt nach der Ankunft ermordet wurde.
Ich danke für die Recherche Frau Laurence Schram vom Jüdischen Deportations- und Widerstandsmuseum (JDWM) in der ehemaligen Mechelner Dossinkaserne. 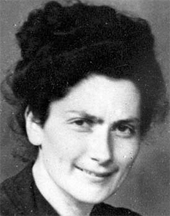 Stefanie Bauer, geb. Kanagur Stefanie Bauer, geb. KanagurStefanie Bauer, Rufname Stefi, wurde am 23.4.1913 in Tarnów in Galizien geboren. Ihre Eltern waren Jacob Kanagur und Gisela, geborene Bernstein am 29.6.1888. Sie hatte einen älteren Bruder namens Siegmund, der am 12.10.1909 in Pawlosiów, Galizien, geboren wurde. Durch den I. Weltkrieg war die Familie gezwungen nach Wien zu flüchten. Da die Eltern und ihre Kinder in Russland bereits deutsche Schulen besucht hatten, hatten sie in Wien keine Sprachprobleme und konnten sich so relativ schnell eingewöhnen und sich eine neue Existenz aufbauen.
Ihr Elternhaus galt als assimiliert und liberal und lebte bis zur Weltwirtschaftskrise in bescheidenem Wohlstand. Trotz der wirtschaftlichen Probleme während der Inflation konnte Stefis Bruder sein Studium in Germanistik und Geschichte abschließen. Auch sie besuchte ein Gymnasium. Nach dem Abitur wollte sie eigentlich Medizin studieren. Aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Situation mit zunehmenden offen gezeigten Antisemitismus verzichtete sie auf das Studium, denn es gab bereits 1929/1930 auch tätliche Übergriffe auf jüdische Studenten an der Universität. So machte sie eine Ausbildung zur Röntgenassistentin im Wiener Allgemeinen Krankenhaus und arbeitete nach dem Abschluss in verschiedenen Wiener Krankenhäusern.
Stefi gehörte zwar keiner Partei an, war aber überzeugte Antifaschistin. Ihr Bruder gehörte der Sozialistischen Jugend und der „Roten Hilfe“ an, ursprünglich in Österreich eine kommunistische Organisation, in der aber nicht nur Kommunisten aktiv waren. Von der Roten Hilfe wurde er ausgeschlossen, nachdem er Kritik geübt hatte, trat jedoch dann trotzdem der kommunistischen Partei bei.
1933/1934 verschärfte sich die Lage in Österreich. Die Republik wandelte sich in einen autoritären Staat, in den sogenannten austrofaschistischen Ständestaat. 1937 folgte Stefi ihrem Verlobten, den Arzt Ignaz Bauer nach Spanien zu den Internationalen Brigaden und trat in den Sanitätsdienst ein. Nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Österreich 1938 folgte ihr der Bruder und kämpfte in Spanien an der Front. Am 12.3.1938 heiratete sie in Albacete Ignaz Bauer, obwohl ihre Eltern gegen diese Heirat waren.
In Spanien war Stefi mit Paula Draxler (siehe dort; es existiert ein Bild der beiden Frauen aus Albacete) befreundet. Außer in Albacete arbeitete sie auch im Spital in Mataró und im Hospital von Santa Coloma de Farnes. In Benicàssim versorgte sie Flüchtlingskinder in einem Heim der Internationalen Brigaden.
Sowohl Stefi wie auch ihr Bruder machten sehr unangenehme Erfahrungen mit den stalinistischen Säuberungen in den Internationalen Brigaden. Es konnte ein Todesurteil sein, als Trotzkist bezeichnet zu werden. Trotzkist war, wer von der stalinistischen Linie abwich. Dennoch trat Stefi nicht der kommunistischen Partei bei und blieb parteilos.
Beim Abzug der Internationalen Brigaden wurde für viele Interbrigadisten Spanien zur Falle. Die es schließlich nach Frankreich schafften, kamen in Auffanglager. Stefi hatte als Angehörige des Sanitätspersonals eine etwas bessere Behandlung und das Lager in Montguyon war nicht ganz so schlimm wie andere Lager. Einem Onkel in Paris gelang es, Stefi nach einem Monat aus ihrem Lager rauszuholen. Diesem Onkel gelang es auch, dass ihr Mann sein Lager verlassen konnte. Für das Ehepaar, das zunächst in Paris lebte, war es ausgesprochen schwierig, denn sie hatten keine regulären Aufenthaltspapiere.
Als ihr Mann im Sommer 1939 das Angebot bekam, in einer spanischen Kinderkolonie als Arzt zu arbeiten, griffen beide zu und sie arbeitete dort als Pflegerin. Das Glück währte nicht lange. Mit dem Kriegsbeginn wurde ihr Mann aus politischen Gründen verhaftet. Zunächst konnte Stefi in der Kinderkolonie bleiben, doch im Dezember 1939 wurde sie aufgelöst und sie kam in ein Lager nach Montgyuon mit erbärmlichen Zuständen. Ihr und zwei Lehrerinnen aus der Kinderkolonie gelang es, ihre Lage in dem Lager zu verbessern. Als das Lager nach dem Einmarsch der Wehrmacht 1940 in Frankreich verlegt wurde, ließ der Bürgermeister die drei Frauen frei.
Stefi machte sich nach Libourne auf, um ihren Mann zu suchen. Sein Lager wurde allerdings auch verlegt. Daraufhin ging sie nach Bordeaux, wo sie andere Österreicher vermutete. Als Bordeaux am 1.7.1940 besetzt wurde, flüchtete sie wie viele andere auch aus der Stadt in Richtung spanische Grenze. Sie begab sich sehr abenteuerlich mit einem Militärzug weiter nach Montauban, wo sie schließlich ihren Mann wiederfand.
Durch Verrat eines ehemaligen Spanienkämpfers flog die dortige österreichische Gruppe auf und ihr Mann wurde wieder festgenommen, einige Wochen später auch sie. Man ließ sie nach zwei Tagen zwar wieder frei, aber entzog ihr die Aufenthaltsduldung, sodass sie nun als Illegale in Frankreich lebte. Ihr Mann wurde als Kommunist zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.
Stefie versuchte sich irgendwie durchzuschlagen, doch ab August 1942 begann auch in der unbesetzten Zone die Auslieferung ausländischer Juden an die Nazis und sie musste endgültig untertauchen. In ihrer Not wandte sie sich an den Bischof von Montauban, der für seine kritische Haltung zur Judenverfolgung bekannt war, nachdem sie vor ihrer eigenen drohenden Deportation gewarnt wurde. Er brachte sie in einem Kloster unter, allerdings waren die Nazis beinahe schneller und sie musste bereits mit Hilfe von französischen Bekannten abtauchen, bevor sie das Kloster erreichte.
In dem Kloster, in dem nach längerem Hin und Her Stefi Aufnahme fand, war eine Anstalt für schwererziehbare und kriminelle Minderjährige. So musste sich Stefi als Diebin ausgeben, die dort zu ihrer Besserung eingewiesen wurde. Fast ein Jahr verbrachte Stefi in dem Kloster. Nur nachts für einige Minuten durfte sie an die frische Luft im Klostergarten aus Angst vor Entdeckung. Im Januar 1943 wurde das Kloster vor einer drohenden Razzia gewarnt und Stefi brauchte ein neues Versteck.
Franzosen und eine Korsin versteckten sie und besorgten ihr eine französische Identitätskarte. Aus Stefi wurde so Marie-Thérèse Lefrancq. Aber die Lage war angespannt und die Gefahr der Entdeckung stets gegeben. Schließlich kam sie zurück ins Kloster, allerdings in kompletter Isolation. Als sie in ihrer Zelle durch Briefe von Freunden aus der Schweiz benachrichtigt wurde, dass ihre Mutter und Großmutter deportiert worden waren, brach Stefi seelisch und gesundheitlich zusammen. Eine hinzugezogene Ärztin machte auch die Lebenssituation von Stefi für ihren Gesundheitszustand verantwortlich, denn in dem Kloster saß sie wie im Gefängnis Tag und Nacht alleine in einer Zelle. So wurde sie in einem Heim für geistig behinderte Kinder untergebracht, wo sie auch mitarbeiten konnte.
Begleitet wurde sie ab nun zu ihrem Schutz von Adeline Brachet, die vorher im Kloster gearbeitet hatte. Als dort vor einer Razzia gewarnt wurde, wechselten sie in ein ähnliches Heim nahe der spanischen Grenze. Aber auch dort war man vor dem Zugriff der Nazis nicht sicher, die dort immer wieder Razzien durchführten, um französische Partisanen der Résistance aufzuspüren. So musste sich Stefi oft tagelang bei Bauern der Umgebung verstecken. Einmal blieb sogar als einziger Fluchtort nur eine Güllegrube übrig., in der sie bis zum Hals in der Jauche stehen musste. Gemessen an den allgemeinen Gefahren konnte sie dort dennoch eineinhalb Jahre relativ sicher leben.
Nach der Befreiung blieb Stefi erst einmal in dem Heim. Die französische Identitätskarte als Marie-Thérèse Lefrancq war ihr einziges Ausweispapier. Anschließend erholte sie sich bei Adeline Brachets Familie. Mit dieser zog sie dann im Herbst 1944 nach Paris und erhielt endlich als Österreicherin Stefie Bauer eine Aufenthaltsgenehmigung, die ihr auch die Heimkehr nach Österreich gestattete, allerdings angesichts der zerstörten Infrastruktur ein schwieriges Unterfangen. In Paris erfuhr sie, dass ihr Ehemann, der in Dachau als politischer Häftling inhaftiert war, an Typhus erkrankt war und nach seiner Genesung nach Salzburg zurückgekehrt war.
Mit einem Kollegen der US-Army-ihres Bruders kehrte sie daraufhin im Dezember 1945 nach Österreich zurück. Ihr Bruder hatte in mehreren Lagern eine schlimme Zeit erlebt, war zuletzt in einem Lager am Rande der algerischen Sahara in Nordafrika verschoben worden, wo er aber Kontakte zur britischen Armee bekam, schließlich dieser beitreten konnte und über diese für die US-Army rekrutiert wurde. Dort erhielt er den Decknamen Kennedy, den er später als Familiennamen behielt. Im Gegensatz zu Stefi erfuhr er erst nach seiner Rückkehr nach Österreich, dass sein Vater verschollen, seine Mutter und Großmutter deportiert und ermordet wurden.
Für Stefi war es in dem Sinne keine Heimkehr. Ihre Ehe zerbrach, 1947 ließ sie sich von Ignaz Bauer scheiden. Ihre Familie war bis auf ihrem Bruder ermordet worden, die Entnazifizierung fand nicht wirklich umfassend statt, der Antisemitismus war nach wie vor mehr oder weniger offen spürbar. Dafür stellten sich die Österreicher nun als Opfer von Nazideutschland dar, vertuschten, verharmlosten, negierten österreichische NS-Verbrechen und schmetterten so jegliche Ansprüche der NS-Opfer auf Wiedergutmachung ab. In diesem Land wollte und konnte Stefi nicht mehr leben.
Nach Frankreich konnte sie nicht zurück, denn die wiesen ab 1949 ehemalige ausländische Spanienkämpfer aus. Versuche, Visa für die USA oder Australien zu erhalten, scheiterten. Auch hier spielte ihre Vergangenheit in Spanien und damit verbundene Nähe zu den Kommunisten eine Rolle während des kalten Krieges. Bei einer Emigration nach Israel hätte Stefi in ein Einwanderungslager mangels Geld gehen müssen. Die waren natürlich nicht vergleichbar mit den Lagern der Nazis, aber alleine das Wort „Lager“ reichte bei Stefi, um diesen Plan zu verwerfen. 1951 wanderte sie schließlich nach Brasilien aus, wo sie als Röntgenassistentin, Krankenschwester und Sekretärin in São Paulo arbeitete.
1963 kehrte Stefi aus gesundheitlichen Gründen nach Österreich zurück. Ihr Bruder erkrankte schwer und sie pflegte ihn bis zu seinem frühen Tod 1967.
Später arbeitete sie als ehrenamtliche Mitarbeiterin im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW).
Am 21.9.1991 schrieb sie: „Mich hat ein sehr grausames Schicksal gezwungen in Österreich zu leben. Die Ermordung meiner ganzen großen Familie in Wien und Polen durch die Nazis habe ich noch immer nicht verwunden. Da ich in den letzten 3 Jahren auch meine wenigen Freundinnen durch den Tod verloren habe, lebe ich mit einer sehr schmerzhaften Neuralgie, 78 Jahre alt ganz vereinsamt in meiner Wohnung.“
Am 12.1.1992 nahm sich Stefanie Bauer das Leben.
Quellen: Diplomarbeit Marlene Pühretmayr: Stefanie und Siegmund Kanagur – eine Geschwisterbiografie (Universität Wien); DÖW; Yad Vashem; Le Maitron https://maitron.fr/; Internationale Frauen im Spanischen Krieg 1936 – 1939 https://internationale-frauen-im-spanischen-krieg-1936-1939.de/; https://sidbrint.ub.edu/ca/node/26528 Universitat de Barcelona Chrisje Beek
Chrisje Beek wurde am 25.7.1891 geboren. Ihr Vater war der Schneider Philip Leon Beek, geboren am 11.1.1848 in Den Helder, der am 4.7.1916 starb. Ihre Mutter Rebecca, geborene Koren am 27.10.1855, starb bereits sehr früh am 2.11.1901.
Ihr jüngerer Bruder Leon, geboren am 11.3.1894, starb einjährig am 29.3.1895. Ihre älteren Geschwister Isaac, geboren am 7.4.1882, und Elisabeth, geboren am 29.12.1886, starben 1936 und 1939. Weitere Geschwister waren Eva, geboren am 15.5.1880, Jacob, geboren am 10.2.1885 und Jansje, geboren am 27.3.1889. Bis auf den Vater kamen alle in Amsterdam zur Welt.
Chrisje war diplomierte Krankenschwester. Wo sie ihre Ausbildung machte, ist nicht bekannt. Vom Judenrat war sie autorisiert, Privatpflegen auszuüben.
Zuletzt hatte sie in der Mesdagstraat 14 I in Amsterdam gewohnt. Dort wohnten auch ihre Schwestern Jansje und Eva, deren Tochter Rebecca Louise und ihre Nichte Rebecca Elizabeth.
Alle Bewohnerinnen der Mesdagstraat 14 I wurden in die Vernichtungslager Sobibor oder Auschwitz verschleppt und umgebracht.
Die Krankenschwester wurde am 26.7.1943 verhaftet und im Durchgangslager Westerbork interniert. Am 24.8.1943 wurde sie nach Auschwitz deportiert.
Chrisje Beek wurde am Tag ihrer Ankunft im Vernichtungslager am 27.8.1943 ermordet. Quellen: Joods Monument; Yad Vashem
Louise Beerenborg
Louise Beerenborg aus den Niederlanden wurde am 17.10.1899 in Zevenbergen geboren. Ihre Eltern waren Gabriel, geboren 1844 in Zevenbergen, und Cato, geborene van Straten 1844. Ihre älteren Geschwister waren Joseph, geboren 1887, Samuel, geboren 1888, Anna Berlin, geboren 1890, Eli, geboren 1891, Hester Polak, geboren 1892, Sara van Straten, geboren 1894, Francisca Katan, geboren 1896, und Eugenie, geboren 1897.
Zuletzt wohnte die Krankenschwester Louise in der Nieuwe Vijzelstraat 3 huis in Amsterdam.
Alle Geschwister starben in Vernichtungslagern.
Louise Beerenborg wurde in das KZ Auschwitz verschleppt und dort am 10.9.1943 ermordet. Quelle: Joods Monument; Yad Vashem; ancestry.com
 Erna Behling, geb. Behnke Erna Behling, geb. BehnkeErna Mathilde Louise Behncke kam am 5.10.1884 in Hamm, Borstelmannsweg 137, zur Welt. Ihre Eltern waren der Arbeiter und Schmied Johann Heinrich Christian Behncke, geb. 1.6.1843 in Schwaberow bei Schwerin und Ida Henriette Wilhelmine, geborene Gehsermann, geboren am 8.2.1844 in Hamburg. Erna hatte drei ältere Stiefgeschwister aus der ersten Ehe des Vaters. 1890 wurde sie durch den Tod des Vaters zur Halbwaise. Da ihre Mutter schwer krank war, kam Erna mit ihrer Stiefschwester Bertha in das Hamburgische Waisenhaus.
Vermutlich besuchte Erna die Schule des Waisenhauses, zumindest in der Zeit, in der sie nicht in eine "Pflegestelle" oder in ein Arbeitsverhältnis vermittelt war. Mit etwa neuneinhalb Jahren wurde Erna Behnke als Dienstmädchen vom Waisenhaus nach Mecklenburg geschickt, wo sie sechs Jahre blieb. Nach ihrer Rückkehr in das Waisenhaus kam es zu einer weiteren Vermittlung. Vermutlich verließ Erna mit sechzehn Jahren endgültig das Waisenhaus.
In den kommenden Jahren musste sie häufig den Wohnort und Arbeitsstellen wechseln. Derartige Wohnungs- und Arbeitsplatzwechsel waren dazumal in der Unterschicht nichts Ungewöhnliches. Dienstmädchen wohnten meist in Logis, waren völlig abhängig und oftmals Übergriffen durch Dienstherren schutzlos ausgeliefert, wurden rücksichtslos ausgebeutet und es genügte oft nur ein Widerwort, um die Stelle zu verlieren. Bei der herrschenden Arbeitslosigkeit war es für die Dienstherren ein Leichtes, sofort Ersatz zu finden.
Am 6.8.1904 heiratete Erna Behnke Johann Carl Bogumil, geboren am 9.10.1880, den sie bereits als Kind aus dem Waisenhaus kannte. Das gemeinsame Kind Rudolf Hermann Albert Bogumil, geboren am 4.10., starb am 8.11. wenige Wochen nach seiner Geburt. Kurze Zeit später hatte sich das Ehepaar vermutlich getrennt. Die Ehe wurde aber erst am 4.4.1910 geschieden. Die Lebensjahre von 1910 bis 1940 konnten bis jetzt nicht rekonstruiert werden. Am 21.9.1940 heiratete Erna Bogumil August Friedrich Behling. In der Heiratsurkunde war die Berufsangabe "Krankenpflegerin" vermerkt. Zu dieser Zeit waren allerdings die Berufsbezeichnungen noch nicht eindeutig reglementiert.
Wann und wo Erna die Krankenpflege erlernte, ist bisher nicht bekannt. Es könnte sein, dass sie beim Roten Kreuz gelernt und gearbeitet hatte, da angeblich ein undatiertes Foto beim VVN von ihr existiert, dass sie in der Rot-Kreuz-Tracht zeigt. Dieses Foto ist aber nicht auffindbar. Da Erna Behling allerdings der KPD angehörte, ist es eher unwahrscheinlich, dass sie dem Deutschen Roten Kreuz angehörte. Da wäre der Arbeiter Samariter Bund wahrscheinlicher, was aber nur eine wage Vermutung ist. Der Arbeiter Samariter Bund hatte in den unterschiedlichen Ortsgruppen keine einheitliche Schwesternkleidung. Ungeübte Augen könnten eine Schwesternkleidung vom ASB mit der vom Roten Kreuz verwechseln. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass sie sich für den Lazarettdienst im ersten Weltkrieg ausbilden ließ. Dann wäre die Rot-Kreuz-Tracht nachvollziehbar.
Es könnte sein, dass Erna Behling sich zur Hebamme fortbilden ließ. Ihr Ehemann erwähnte es einmal 1946 in einem Fragebogen. Auch Bewohner der Hamburger Löwenstraße 5, wo Erna ab 1940 lebte, meinten, sich an diese Tätigkeit zu erinnern.
Es ist auch nicht bekannt, wann sie der KPD beitrat. Sie soll sich am Hamburger Aufstand 1923 beteiligt haben, bei dem sie den Spitznamen „die rote Krankenschwester“ erhielt. Dieser bewaffnete Aufstand war von den Kommunisten im Oktober 1923 losgeschlagen worden. Sie nahmen an, dass die Bevölkerung auf ihrer Seite aktiv am Aufstand eingreifen würde, da die wirtschaftliche und politische Krise in Deutschland sich so zugespitzt hatte, dass im Lande eine extreme Unzufriedenheit herrschte. Die Bevölkerung unterstützte den Aufstand jedoch nicht aktiv, sodass der Aufstand nach einigen Tagen scheiterte.
Vermutlich war Erna Behling nach dem Aufstand, wie viele Mitstreiter*innen auch, in Haft. Mit ihrem Mann gehörte sie einer kleinen Widerstandsgruppe an, die wiederum zum Netz der “Bästlein-Jacob-Abshagen-Gruppe“ gehörte. Unter anderem war eine Aufgabe dieser Widerstandsgruppe, die Rundfunksendungen der Alliierten abzuhören und die Nachrichten zu verbreiten, um die Nazipropaganda zu durchbrechen.
Ende 1944 wurden die Behlings denunziert und verhaftet. Erna Behling kam mit den anderen festgenommenen Frauen als Schutzhäftling der Gestapo in die Gestapofrauenanstalt Fuhlsbüttel. Im April 1945 sollten die Frauen ins KZ Neuengamme verlegt werden. Dazu die Zeitzeugin Ellen Katzenstein: „Die Frauen ahnten nicht, was ihnen bevorstand. Da kein Gerichtsverfahren gegen sie lief, nahmen sie an, sie würden vielleicht mit einem kurzen Übergang im ‚Hüttengefängnis' entlassen werden. Alle befanden sich in freudiger Erregung. Sie zeigten sich gegenseitig die Bilder ihrer Männer und Kinder (Erika Etter wusste nicht, dass ihr Mann bereits hingerichtet war), richteten ihre Kleidung so nett wie möglich her. Erika, die jüngste, trug weiße Kniestrümpfe. Die Haare wurden hübsch gelegt und Lippenstifte ausgeliehen.“
Im KZ Neuengamme wurde Erna Behling nachts am 22.4.1945 mit elf Mitstreiterinnen ohne Gerichtsurteil brutal ermordet. Weitere 58 männliche Widerstandskämpfer wurden trotz Gegenwehr ebenfalls am nächsten Tag umgebracht. Ihr Ehemann überlebte die Nazizeit.
Heute erinnert an Erna Behling die Erna-Behling-Kehre, eine Straße in Hamburg. Außerdem wurde ein Stolperstein in der Löwenstraße 5 in Hamburg-Hoheluft-Ost, ihrem letzten Wohnort, verlegt.
Quelle: Stolpersteine Hamburg: Recht herzlichen Dank an Johannes Grossmann für seine Recherche
Else Behrend-Rosenfeld: siehe Dr. Else Rosenfeld, geb. Behrend Kostenlose Homepage von Beepworld Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular! |